
Mitarbeiter:in Vertragsmanagement (m/w/d) Stadtverwaltung Leonberg

Energiemanager (m/w/d) - Gebäudemanagement HessenEnergie Gesellsc...
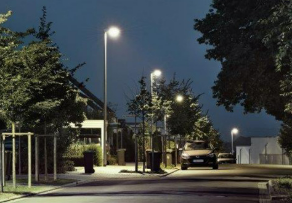
Projektingenieur Schwerpunkt Beleuchtungsmodernisierung (m/w/d)
Wasserstoff trifft Wärmewende: Zittauer Versuchsanlage koppelt Elektrolyseur mit Wärmepumpe und Fernwärmenetz
Die neue Laboranlage „LA-SeVe“ in Zittau koppelt erstmals einen PEM-Elektrolyseur mit einer Großwärmepumpe und speist die gewonnene Wärme ins städtische Fernwärmenetz ein. Die Versuchsanlage ist Teil des Leitprojekts H2Giga und demonstriert, wie bisher ungenutzte Nebenprodukte der Wasserstoffelektrolyse in Wert gesetzt werden können – mit großem Potenzial für industrielle Anwendungen.
Technologie-Kopplung mit Vorbildcharakter
Wärme und Sauerstoff sind Nebenprodukte, die bei der Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse anfallen. Bislang reduzieren Kühlsysteme die Abwärme, der Sauerstoff wird in die Umgebung abgegeben. Könnten die Nebenprodukte jedoch genutzt werden, verringerten sich die Kosten – gerade bei großtechnischen Elektrolyseanlagen. An diesem Ziel forscht das H?Giga-Projekt IntegrH2ate. Dazu haben die Projektbeteiligten verschiedene Betriebsstrategien entwickelt und unterschiedliche Möglichkeiten verglichen, wie sich die Nebenprodukte einsetzen lassen. Die im Projekt entwickelten Konzepte werden nun mit der neuen „Laboranlage Sektorengekoppelte Verwertung der PEM-Elektrolyseprodukte“ (LA-SeVe) getestet.
Mit der Eröffnung der Laboranlage „LA-SeVe“ hat das Fraunhofer IEG gemeinsam mit Projektpartnern wie der Linde GmbH einen bislang einzigartigen Demonstrator zur sektorengekoppelten Nutzung der PEM-Elektrolyse vorgestellt. Kernstück der Anlage ist die Verbindung eines Elektrolyseurs mit einer Großwärmepumpe, die die bislang ungenutzte Abwärme auf 90 bis 95 Grad Celsius anhebt und in das Fernwärmenetz der Stadtwerke Zittau einspeist.
Bisher galt die Abwärme aus der Wasserstoffproduktion als schwer nutzbar, da sie mit rund 50 Grad Celsius eine zu niedrige Temperatur aufweist. Die Kopplung mit der Wärmepumpe verändert diese Gleichung grundlegend. „Damit werden wir nachweisen, dass die Auskopplung und die effektive Nutzung des Elektrolyseproduktes Wärme die Wirtschaftlichkeit der Elektrolyse verbessert. Mittelfristig wird dies die Umsetzung von Elektrolyseprojekten mit Sektorenkopplung vorantreiben und den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft unterstützen“, so Thomas Emmert von der Linde GmbH und Gesamtprojektkoordinator von IntegrH2ate.
Auch die Bundesforschungsministerin Dorothee Bär unterstrich bei der Einweihung die Bedeutung der Anlage für die Transformation: „Hier in Zittau ist die Forschung außerdem ein Baustein des Strukturwandels, der traditionelle Kompetenzen weiterentwickelt und zur Gestaltung der Zukunft einsetzt.“
Praxistest für industrielle Sektorenkopplung
Die Versuchsanlage in Zittau dient der Entwicklung und Optimierung von Betriebsstrategien für die gekoppelte Nutzung von Strom, Wärme und Wasserstoff. Je nach Ziel – etwa der Nutzung von Überschussstrom oder der Wasserstoffeinspeisung – wird der Elektrolyseur unterschiedlich betrieben. Die dynamische Betriebsweise stellt dabei auch Anforderungen an die Nutzung der Nebenprodukte.
Neben der Abwärme fällt bei der Elektrolyse auch Sauerstoff an, der bisher meist ungenutzt entweicht. Im Rahmen von IntegrH2ate wird auch untersucht, wie dieser aufgereinigt und verdichtet werden kann, um ihn industriell oder medizinisch nutzbar zu machen.
Projektleiter Clemens Schneider vom Fraunhofer IEG betont: „Wir erproben im Technikums-Maßstab, wie sich die Nebenprodukte Wärme und Sauerstoff aus der Elektrolyse bei dynamischer Betriebsweise optimal aufbereiten lassen. Zudem stellt die Versuchsanlage eine Plattform dar, um zukünftig industrienahe Prozesse für Hersteller und Betreiber zu testen und zu qualifizieren.“ Dazu gehören z. B. die Methanisierung von CO2, geschlossene Kohlestoffkreisläufe, Tests von Verdichtern für Sauerstoff und Wasserstoff sowie Wasserstoffbrenner und weitere Komponenten zur Nutzung der Haupt- und Nebenprodukte aus der PEM-Elektrolyse.
Auch Oberbürgermeister Thomas Zenker sieht in der Anlage ein Leuchtturmprojekt: „Wir können in unserer Hochschulstadt Zittau stolz darauf sein, wenn mit dem Fraunhofer IEG ein weiterer innovativer Akteur die Netzwerke am Forschungsstandort ergänzt.“
Die Erkenntnisse aus Zittau sollen als Blaupause für großtechnische Anwendungen dienen. Gerade für Industrieprozesse mit hohem Energiebedarf bietet die gekoppelte Nutzung von Strom, Wasserstoff, Wärme und Sauerstoff neue wirtschaftliche Perspektiven. Ein wichtiger Impuls für die Transformation von Energiesystemen - und für den Strukturwandel in Regionen wie der Lausitz.
© IWR, 2025
Dezentrale Wasserstoffproduktion: ABO Energy und Hydropulse starten strategische Partnerschaft für grünen Wasserstoff in Europa
FormaPort-Forschungsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern setzt neue Maßstäbe für Wasserstofftransport und -speicherung
Meilenstein für Hochlauf der Wasserstoffindustrie: Enertrag startet 130-MW-Wasserstoffprojekt in Prenzlau
Wasserstoffbeschleunigungsgesetz: Bundesregierung vereinfacht Verfahren und weicht Herkunftsanforderungen für Wasserstoff auf
Original PM: ENERTRAG sichert Standort für 130-Megawatt-Wasserstoffproduktion in Prenzlau
Cybersicherheitsgesetz in der Kritik: Energieverbände warnen vor Verzögerungen bei Energiewende und Digitalisierung
 © Paul Glaser/Fraunhofer IEG
© Paul Glaser/Fraunhofer IEG Artikel teilen / merken
Artikel teilen / merken



